Aber bitte nicht selbst drin wohnen
Das bindet zu sehr und ist steuerlich ungünstig
-Bruno Hidding-
Wir alle hören es seit langen Jahren. Deutschland habe mit seiner geringen Wohneigentumsquote international einen riesigen Nachholbedarf. Während in vielen anderen europäischen Ländern 60 bis 80 Prozent der Haushalte in den eigenen vier Wänden wohnen, dürften es in Deutschland nur gut 40 Prozent sein und in den Großstädten sogar noch deutlich weniger. Das war auch einer der Gründe, weshalb über Jahre und Jahrzehnte das Ansparen und Errichten eines eigenen Häuschens mit den unterschiedlichsten Maßnahmen vom Staat gefördert wurde. Die Eigenheimzulage ist Anfang 2006 zwar ausgelaufen, dafür gibt es jetzt den sogenannten Wohn-Riester.
Recht plötzlich zeichnet sich jedoch in Sachen Wohneigentumsquote ein Umdenken ab. Die Argumentationsketten laufen dabei auf verschiedenen Bahnen. So ist immer häufiger die Meinung zu hören, dass bei einem selbstgenutzten Eigenheim nicht von einer guten Kapitalanlage und einer zweckmäßigen Altersvorsorge geredet werden könne. Denn dabei werde in fataler Weise das wichtigste Auswahlkriterium einer Immobilie, die Standortwahl, verletzt. Zum einen werde aus Kostengründen oft am Stadtrand gebaut, zum anderen werde der Makrostandort nach dem Sitz des aktuellen Arbeitgebers ausgewählt. Das binde heutzutage zu sehr an die Region und könne der Karriereplanung im Wege stehen. Sinnvoller sei es, weiter zur Miete zu wohnen und eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Denn dann müsste der Standort der Immobilie nicht der persönlichen Situation, z.B. einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder der größer werdenden Familie, angepasst werden. Auch unter Steuer- und Abschreibungsgesichtspunkten sei dieser Weg sinnvoller. Zudem gebe es später das Problem eines viel zu grossen Hauses nicht, wenn die Kinder auszögen. Ganz zu schweigen davon, dass mit der Alterung sich das Anforderungsprofil an das gewünschte Haus ändert, sei es in Bezug auf die Größe, die Lage, den Zuschnitt oder auch die Frage der Barrierefreiheit.
Verständlich, dass sich bei dieser Argumentation vielen Häuslebauern etwas im Magen herum dreht. Denn diese rationale Reißbrettargumentation vernachlässige völlig die irrationale Seite des Wunsches nach etwas eigenem für die Familie, nach ungestörtem, freiheitlichem Wohnen und damit einer gehobenen Lebensqualität. Doch stellt sich dann sofort die Frage, wieso die indirekte Immobilienanlage in offenen und geschlossenen Immobilienfonds in Deutschland so beliebt ist wie in keinem anderen Land der Welt. Offenbar können also deutsche Anleger sich eher für Bürohäuser in Australien, Kanada oder Amerika begeistern als für den Erwerb eines eigenen Häuschens mit Garten. Seit Jahren steigt nämlich die Wohneigentumsquote nicht mehr, wohl aber das in indirekten Immobilien angelegte Vermögen. Hier beißt sich doch offensichtlich was, oder?
Und gerade diese Anlageform und Verhaltensweise der Deutschen halten eine zunehmende Zahl an Immobilienspezialisten für modern und vorbildhaft. Das Investment in das eigene Haus sei emotional motiviert, das indirekte Immobilieninvestment in Fonds oder Immobilienaktien hingegen rational motiviert. Auch unter dem Gesichtspunkt der Diversifikation, also Risikostreuung sei es nicht sinnvoll, die eigenen Mittel fast gänzlich in ein Haus zu stecken. So würde kein Wertpapiersparer alle seine Mittel in eine Aktie stecken anstatt in Fonds mit einer breiten Risikostreuung.
Das wirft sofort die Frage auf, ob die derzeitige staatliche Immobilienförderung noch sinnvoll ist? Und warum sind fremdvermietete Immobilien ausgenommen, warum indirekte Immobilienanlagen? Unter den genanten Aspekten müsste das Fazit so lauten: Die staatliche Förderung folgt einem anachronistischen Verständnis von Immobilienanlagen und wird dem Paradigmenwechsel, der in einer modernen Gesellschaft eher in Richtung indirekter Anlagen weist, nicht gerecht. – Der Autor dieser Zeilen mag rückständig wirken, denn er bleibt vorerst in seinem Häuschen.





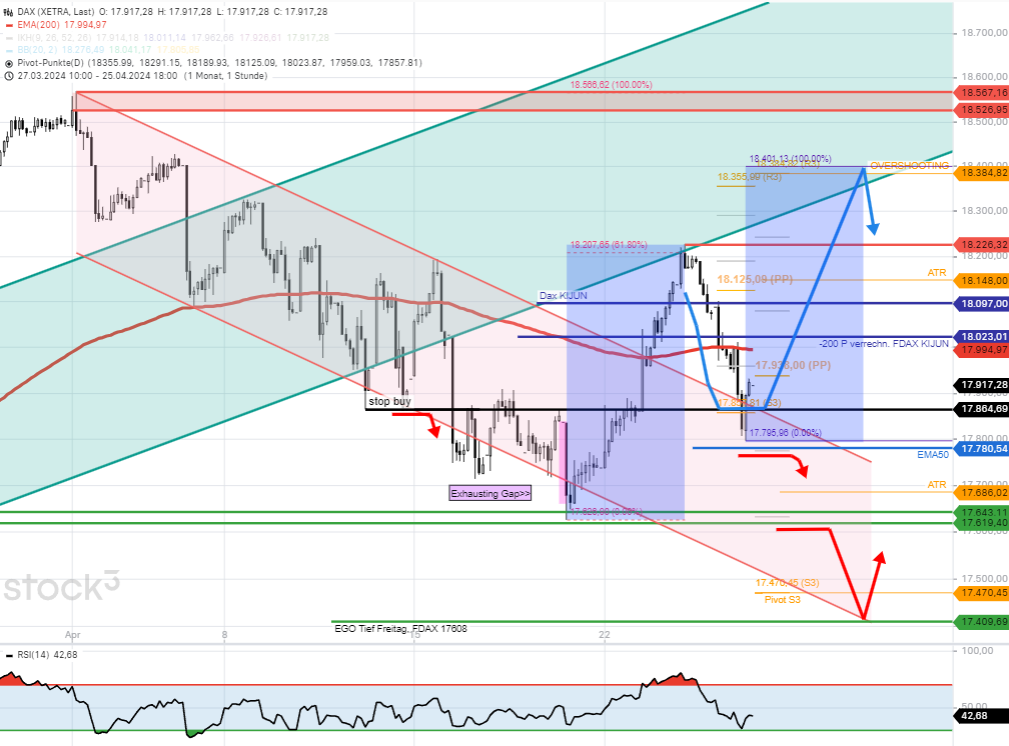


Kommentare
Die "rationale Motivation" wird sich künftig in Anbetracht der auf uns zu rollenen "Gewerbeimmobilien Problematik" wohl in einem schwarzen Loch wiederfinden. Wann werden deutsche Sparer endlich aufwachen und den
Schwindel erkennen ...
autor dusty hat die Sache schon erkannt, denn es droht bereits in vielen Städten der Welt eine Inmobilienschwämme. Dies besonders im Bereich von Büroräumen, die kaum noch jemand bezahlen (siehe Tokio) kann. Aufgrund der Wirtschaftskrise fehlen zudem noch Firmen (die ja nicht mehr da sind), die diese Räumlichkeiten noch anpachten. Dann lieber in meinen vier Wänden Musik hören wann ich will und auch noch so laut wie ich will. Das ist auch ein Stück Freiheit, die man sich in der Regel nehmen kann wann man will.
Gruss H.S.
Der Neubautrend geht scheinbar teilweise in Richtung Bungalows, also auch kostenschonend (oft ohne Keller), und zurückhaltende aber ausreichende Wohnflächengröße. Sind hier Immobilienverwalter, die aus Ihrer Erfahrung berichten können, wohin der Eigenheimtrend gerade geht (aus Käufersicht)?